Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da!
Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da! Galerie der Gegenwart: Das Programm der Spielzeit 2024 & 2025 ist da!
Spie
lzeit 2024
& 2025
Das Programm der neuen Spielzeit ist da!
HEUTE IM THALIA THEATER
HEUTE IM THALIA GAUSSSTRASSE
Aktuell

State of A
ffairs
von Yael Ronen und Roy Chen
Regie Yael Ronen
Uraufführung am 4. Mai

Faust Gretc
hen Fraktur
Ein Langgedicht nach Goethe / Regie Lorenz Nolting
Premiere am 26. April im Thalia Gaußstraße

S
chande
von Ingmar Bergman / Regie Mattias Andersson
wieder am 19. April
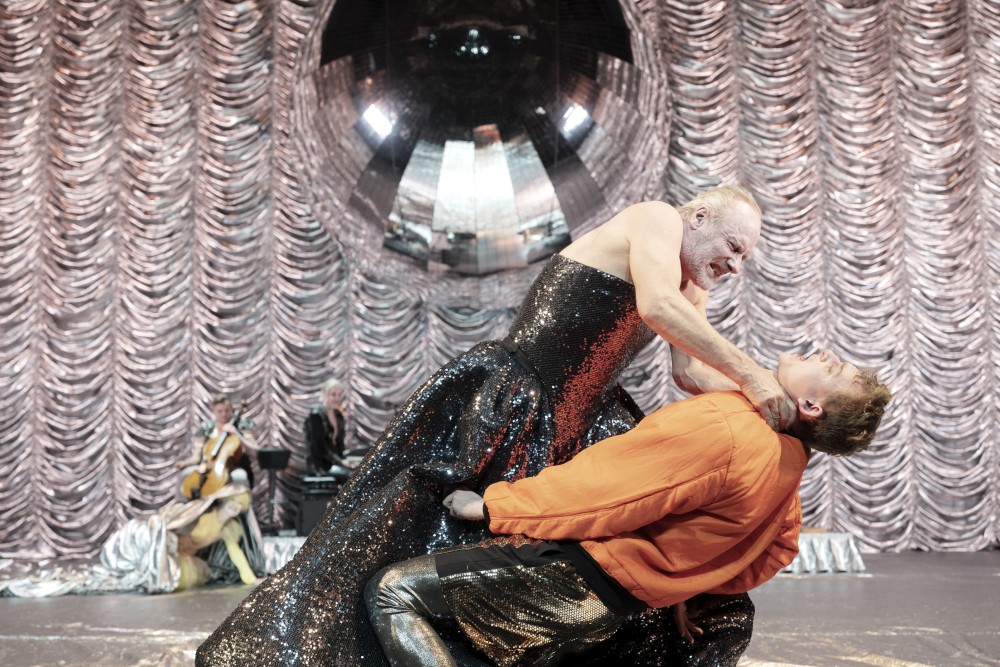
König L
ear
von William Shakespeare / Regie Jan Bosse
wieder am 29. April im Thalia Theater
Die Spielzeit 2024 & 2025

ThaliaSo
mmerCards
Allein, zu zweit oder für U30: 3 Monate lang volles Programm zum halben Preis!

Thali
aDigital
Unsere neue Mediathek mit exklusiven Backstage-Einblicken, Interviews, Podcasts, Reiseberichten und mehr.
Digitales Eintauchen vor, auf und hinter die Bühne!

Thali
aShop
Thalia to go: Socken, Taschen, Mützen, Sweatshirts, Bücher und vieles mehr.
Jetzt in unserem Shop stöbern!
Hier den Thalia Newsletter bestellen

